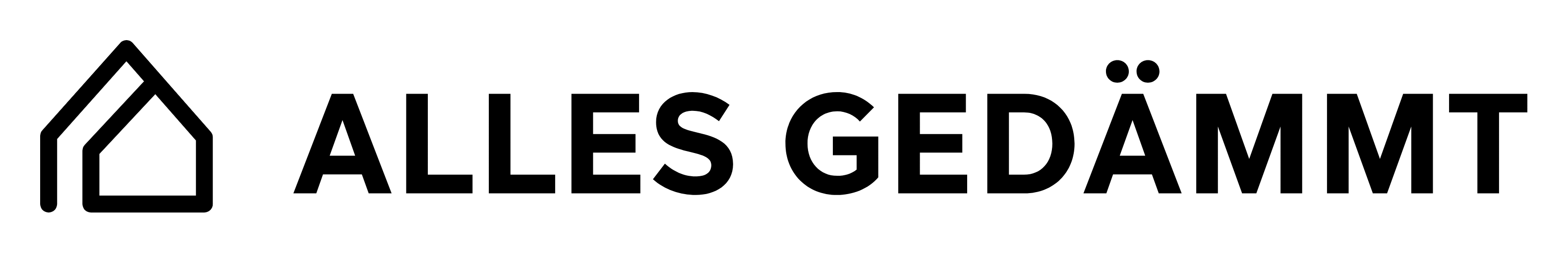1. Was ist eine Einblasdämmung?
Eine Einblasdämmung ist loses Dämmmaterial, das unter Druck in Hohlräume von Wänden oder Dächern geblasen wird, um die Wärmeeffizienz zu steigern. Das Material wird durch kleine Bohrlöcher eingebracht und verteilt sich gleichmäßig. So werden Wärmeverluste verringert und das Raumklima verbessert.
2. Wo kann eine Einblasdämmung eingesetzt werden?
Einblasdämmung ist besonders flexibel einsetzbar. Voraussetzung ist lediglich ein ausreichend großer Hohlraum, in den das Dämmmaterial eingebracht werden kann. Typische Anwendungsbereiche sind:
- Fassaden mit zweischaligem Mauerwerk
- Kellerdecken
- Dachböden
- Dachschrägen
- Flachdächer
Besonders schwer zugängliche Bereiche – wie sie im Dachbereich häufig vorkommen – können optimal gedämmt werden.
3. Wie funktioniert eine Einblasdämmung?
Die Funktionsweise einer Einblasdämmung ist einfach und effektiv: Loses Dämmmaterial wird in die Hohlräume eines Gebäudes eingeblasen, um die Wärmeeffizienz zu verbessern. Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Ablauf des Prozesses:
- Analyse der Hohlräume: Zunächst wird geprüft, wie groß die Hohlräume sind und ob sie für das Dämmmaterial geeignet sind. In vielen Fällen kommt eine Kamera zum Einsatz, um die Hohlräume zu inspizieren und den besten Dämmstoff auszuwählen.
- Vorbereitung (Bohrung von kleinen Löchern): Kleine Löcher von etwa 2 bis 2,5 cm Durchmesser werden in die Wand gebohrt. Diese Löcher ermöglichen das Einblasen des Dämmmaterials und können auch an bestehenden Öffnungen wie Fensterrahmen oder Steckdosenbohrungen erfolgen.
- Einblasen des Dämmmaterials: Ein spezielles Gerät bläst das Dämmmaterial unter hohem Druck in die Hohlräume. Das Material wird dabei gleichmäßig verteilt, um eine lückenlose Dämmung zu gewährleisten.
- Verdichtung: Das Dämmmaterial wird verdichtet, um Lücken zu verhindern und eine stabile Isolierung zu bieten. Dadurch wird sichergestellt, dass keine Wärmebrücken entstehen und die Dämmung optimal wirkt.
- Abschlussarbeiten: Nach dem Einblasen des Dämmmaterials werden die Bohrlöcher wieder verschlossen. Fachbetriebe führen abschließend Tests mit Thermografie-Kameras oder Blower-Door-Tests durch, um die Effektivität der Dämmung zu überprüfen.
4. Dämmmaterial für eine Einblasdämmung
Für die Einblasdämmung steht eine breite Palette an Dämmmaterialien zur Verfügung. Sie lassen sich in drei Hauptgruppen unterteilen: ökologische bzw. organische, mineralische und synthetische Dämmstoffe.
Ökologische oder organische Dämmstoffe für eine Einblasdämmung
Ökologische oder organische Dämmstoffe sind umweltfreundlich, weil sie oft aus natürlichen oder recycelten Materialien hergestellt werden. Sie bieten nicht nur gute Dämmwerte, sondern fördern auch nachhaltige Nutzung. Beispiele dafür sind:
- Holzfaser: Hergestellt aus unbehandeltem Nadelholz, eignet sich für Dachdämmungen, Wände im Holzrahmenbau und Deckendämmungen. Sie bietet guten Sommerwärmeschutz und Schallschutz und ist diffusionsoffen sowie feuchtigkeitsregulierend. Holzfaser kann recycelt werden und erfordert einen höheren Druck beim Einblasen als Zellulose.
- Lederfasern: Ein innovativer Dämmstoff, der aus upgecycelten Lederfasern entsteht. Aufgrund seiner hohen Dichte eignet sich das Material besonders gut für Schalldämmung, etwa in Geschossdecken.
- Stroh: Eine nachhaltige Einblasdämmung aus Weizenstroh, die hohe Wärmespeicherfähigkeit, Schallschutz und sommerlichen Hitzeschutz bietet. Besonders geeignet für Dachdämmungen und Holzrahmenbau.
- Zellulose: Wird aus alten Zeitungsrückläufern (Recyclingmaterial) hergestellt. Zellulose eignet sich hervorragend für die Dämmung von Dachschrägen, Flachdächern, Dachböden und Innenwände im Einblasverfahren. Sie speichert Feuchtigkeit und gibt sie bei Wärme wieder ab, solange eine Seite nicht vollständig diffusionsdicht ist.
Mineralische Dämmstoffe für eine Einblasdämmung
Mineralische Dämmstoffe bieten robuste Lösungen, die besonders feuerfest sind und sich gut gegen äußere Einflüsse behaupten. Sie gewährleisten zudem eine sehr effektive Wärmedämmung. Dazu gehören:
- Steinwolle: Granulat, das sich hervorragend für die Kerndämmung eignet, besonders bei Flachdächern, Kuppeln und Gewölben. Steinwolle ist nicht brennbar und hat einen hohen Schmelzpunkt von über 1.000 °C. Sie ist beständig gegen Feuchtigkeit, verliert jedoch ihre Dämmwirkung bei zu hoher Feuchtigkeit.
- Glaswolle: Leichte und nicht brennbare Flocken, die gut zur Kerndämmung von zweischaligem Mauerwerk geeignet sind. Sie bieten Schallschutz und sind beständig gegen Schimmel, Fäulnis und Schädlinge.
- Perlite: Ein Dämmstoff aus vulkanischem Glas, der häufig als Schüttdämmung verwendet wird, aber auch bei der Kerndämmung zum Einsatz kommt. Perlite ist resistent gegen Insekten, verrottet nicht und hat eine geringere Isolierwirkung als EPS-Kügelchen oder Glasfaser (Wärmeleitgruppe 050).
- Blähglas: Besteht aus Glas, Wasser und Zusatzstoffen. Wird vor allem in Haustrennwänden erdbedeckter Bereiche eingesetzt. Es ist wasserunempfindlich, druckfest und eignet sich besonders für Anwendungen mit mechanischer Belastung. Es bietet gute Wärmeisolierung und ist robust gegenüber Belastungen.
- Nanogel / Aerogel: Bietet beste Wärmeisolierung mit der niedrigsten Wärmeleitfähigkeit, eignet sich für dünne Schichten und enge Öffnungen, etwa bei der Dämmung von zweischaligem Mauerwerk. Nachteil: Es kann durch Balkenauflager in Decken und Wände gelangen und Staub hinterlassen.
Synthetische Dämmstoffe für die Einblasdämmung
Synthetische Dämmstoffe sind eine weitere Option für die Einblasdämmung. Sie bieten eine gute Dämmleistung und lassen sich einfach verarbeiten, obwohl sie im Vergleich zu natürlichen Alternativen weniger umweltfreundlich sind. Zu diesen Materialien zählt EPS.
EPS-Granulat wird hauptsächlich zur Einblasdämmung bei Fassaden verwendet und füllen schmale Hohlräume. Ein Nachteil ist, dass bei undichten Mauerkronen oder Rohrdurchführungen entsprechende Vorkehrungen getroffen werden müssen, damit die Kügelchen nicht austreten.
5. Was kostet eine Einblasdämmung?
Die Kosten für eine Einblasdämmung variieren je nach Dämmmaterial, baulichen Gegebenheiten und dem Arbeitsaufwand. Faktoren wie die Größe der zu dämmenden Fläche, die Zugänglichkeit der Hohlräume und die Region spielen ebenfalls eine Rolle.
Um Ihnen einen besseren Überblick über die Kosten der Einblasdämmung zu bieten, stellt die folgende Tabelle die Preise für verschiedene Gebäudeteile wie Dach, Fassade und weitere Bereiche dar.
Tipp: Es lohnt sich, mehrere Angebote von Fachfirmen zu vergleichen. So finden Sie die beste Lösung für Ihr Dach und sparen Geld. Nutzen Sie unser Formular, um kostenlos Angebote von Fachbetrieben aus Ihrer Region zu erhalten.
6. Förderung für Einblasdämmung: Welche Möglichkeiten gibt es?
Sie können die Kosten für eine Einblasdämmung reduzieren, indem Sie verschiedene Förderprogramme nutzen. Die wichtigsten Fördermöglichkeiten sind hier aufgeführt:
- Steuerliche Förderung: Seit 2020 gibt es die Möglichkeit, Maßnahmen zur energetischen Sanierung steuerlich abzusetzen. Dies umfasst auch die Einblasdämmung. Sie können bis zu 20 % der Sanierungskosten über drei Jahre verteilt von der Steuer absetzen, was Ihnen eine direkte Kostenentlastung ermöglicht.
- BAFA-Zuschuss: Die BAFA fördert ebenfalls energetische Sanierungen, einschließlich Einblasdämmung, mit Zuschüssen von bis zu 20 % Ihrer Investitionskosten. Voraussetzung ist, dass die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchgeführt werden und die verwendeten Dämmmaterialien bestimmte Standards erfüllen
Neben der steuerlichen Förderung und dem BAFA-Zuschuss bietet die KfW den Ergänzungskredit (358/359) an. Dieser zinsgünstige Kredit wird jedoch nur gewährt, wenn Sie bereits einen Bewilligungsbescheid der BAFA vorliegen haben. Darüber hinaus gibt es auch regionale Förderprogramme der Bundesländer und Kommunen, die für ein Dämmvorhaben in Erwägung gezogen werden können.
Sie möchten mehr erfahren? In unserem ausführlichen Ratgeber zur Förderung einer Einblasdämmung erhalten Sie einen umfassenden Überblick zu allen Fördermöglichkeiten.
7. Einblasdämmung selbst machen: Ja oder nein?
Nein, eine Einblasdämmung sollten Sie nicht selbst durchführen, da das Verfahren spezielle Maschinen erfordert, die das Dämmmaterial unter hohem Druck in die Hohlräume einbringen. Außerdem sind Fachwissen und Erfahrung notwendig, um eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten und Wärmebrücken oder Bauschäden zu vermeiden.
Zudem kann eine unsachgemäße Ausführung die Dämmwirkung erheblich beeinträchtigen. Aus diesen Gründen ist es empfehlenswert, die Arbeiten von einer Fachfirma durchführen zu lassen.
Vorteile, wenn ein Fachbetrieb die Einblasdämmung übernimmt:
- Schnelles und zuverlässiges Ergebnis
- Beratung über das passende Dämmmaterial
- Vermeidung von späteren Schäden und teuren Reparaturen
- Der Handwerker bringt die nötigen Geräte mit
- Sie profitieren von einer Gewährleistung
8. Vorteile und Nachteile der Einblasdämmung
Die Einblasdämmung bietet viele Vorteile, hat aber auch einige Nachteile, die bedacht werden sollten. Hier ist ein Überblick:
9. Bonus: Fachfirma für Einblasdämmung finden
Die Einblasdämmung ist eine effiziente Methode zur energetischen Sanierung, beispielsweise bei Altbauten mit schwer zugänglichen Hohlräumen. Sie lässt sich schnell umsetzen, ist vergleichsweise kostengünstig und verursacht nur minimale Eingriffe in die Bausubstanz.
Um die Investitionskosten zu senken, können staatliche Förderprogramme wie BAFA-Zuschüsse oder steuerliche Abschreibungen in Anspruch genommen werden.
Brauchen Sie Hilfe bei der Umsetzung Ihrer Einblasdämmung? Über unser Formular können Sie kostenlos und unverbindlich Angebote von Fachbetrieben aus Ihrer Region anfordern und die beste Lösung finden.